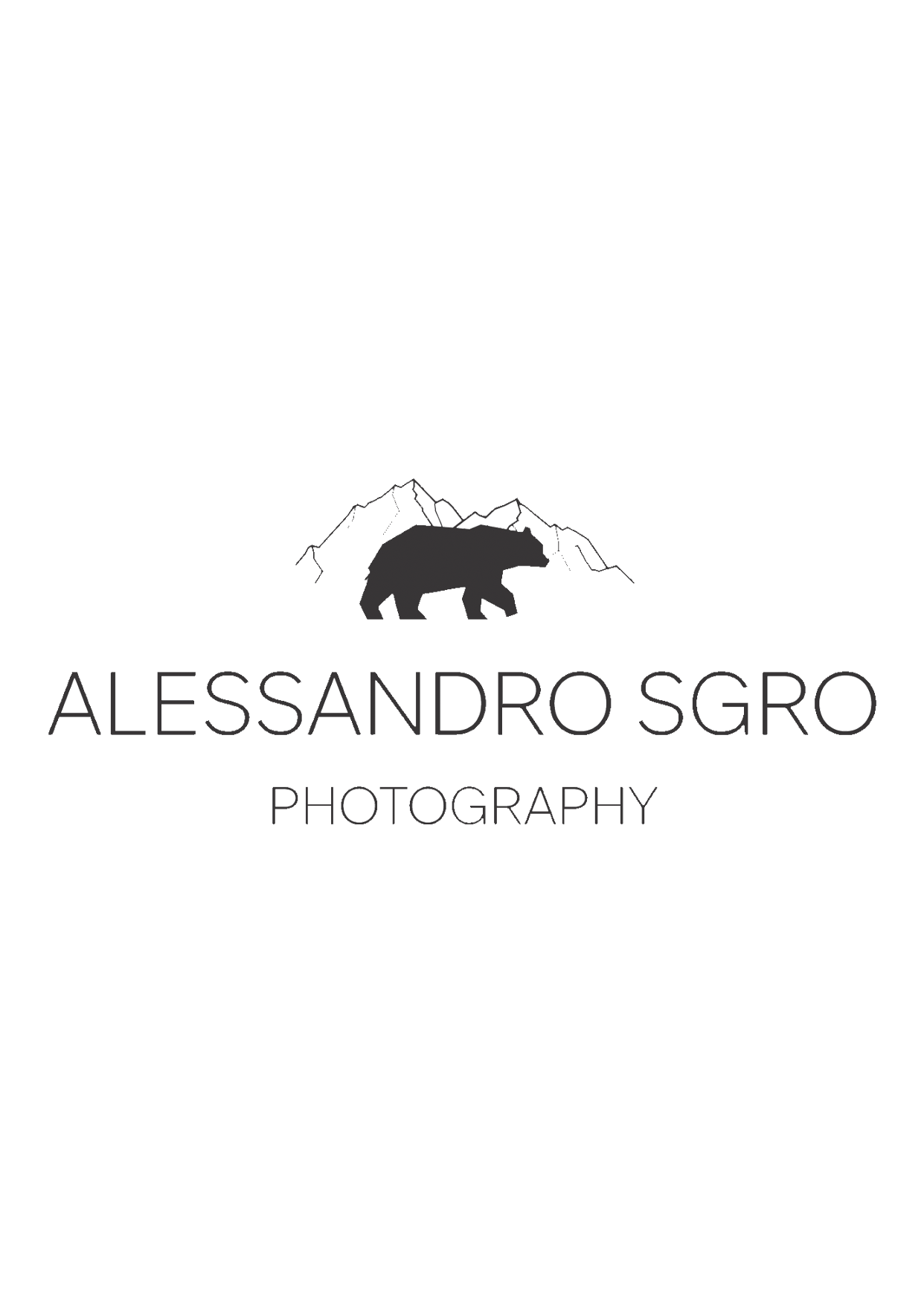Wolfsmonitoring
Das Wolfsmonitoring umfasst sowohl aktive als auch passive Methoden. Genetische Analysen sind ein wichtiger Bestandteil des Monitorings. Anhand genetischer Informationen können beispielsweise benachbarte Rudel abgegrenzt und mögliche Einwanderungen aus benachbarten Wolfspopulationen identifiziert werden. DNA-Proben werden ganzjährig gesammelt. Der Großteil der Proben wird nicht-invasiv gewonnen, beispielsweise durch frischen Kot, Urin (auf Schnee), Haare oder Speichel (Abstriche von kürzlich getöteten wildlebenden Huftieren oder Nutztieren). Eine effektive Methode, genetische Proben wie Wolfskot zu finden, ist die Arbeit mit ausgebildeten Artenspürhunden, die darauf trainiert sind, Wolfskot aufzuspüren und anzuzeigen. Gemeinsam mit meinem Artenspürhund Romeo suchen wir im wissenschaftlichen Rahmen nach Hinweisen und Aktivitäten von Wölfen, insbesondere in unserer Heimatregion der Nordeifel, wo wir ein aktives Monitoring etabliert haben. Hier arbeiten wir freiberuflich für das Landesamt für Natur, Umwelt & Klima in Nordrhein-Westfalen. In der Vergangenheit haben wir das Lupus Institut bereits mehrfach freiberuflich erfolgreich im Wolfsmonitoring und der Wolfsforschung im Freiland und bei der Aufbereitung der erhobenen Daten unterstützt und konnten dort wertvolle Erfahrungen sammeln. Bei Interesse an unserer Arbeit oder bei Presseanfragen können Sie mich gerne über das Kontaktformular kontaktieren.
Frischer Wolfskot erschnüffelt durch Romeo.
Dokumentieren aller wichtigen Daten wie Maße, Standort etc.
Frischer Kot eignet sich für die genetische Probenahme.
Typischer Wolfskot voller Haare seiner Beute.